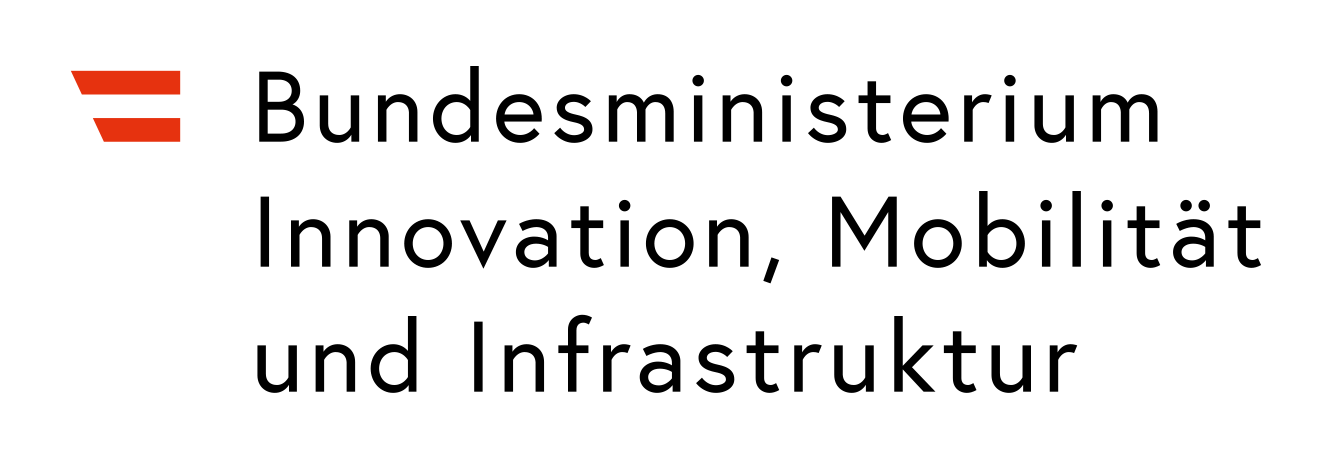Neue Rahmenbedingungen für Bauwerksbegrünungen
Grüne Infrastruktur gewinnt in Österreich an Bedeutung: Neue Vorgaben, Förderungen und EU-Richtlinien fördern Dach- und Fassadenbegrünungen, um Städte klimaresistenter und energieeffizienter zu machen.
Österreich setzt auf eine Vielzahl von Begrünungsstrategien, um den Herausforderungen des Klimawandels entgegenzuwirken. Eine Übersicht über entsprechende Vorgaben und Förderungen ist auf der GRÜNSTATTGRAU-Webseite zu finden. Insbesondere Dach- und Fassadenbegrünungen spielen dabei eine wesentliche Rolle und sind in unterschiedlichen Förderprogrammen sowie Bauordnungen berücksichtigt.
Die neue EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) hebt die Bedeutung von Begrünungsmaßnahmen im urbanen Raum hervor. Ziel ist es, sowohl die Anpassung an den Klimawandel als auch die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. In Artikel 8 wird betont, dass bei der Planung und Sanierung von Gebäuden eine hohe Kapazität zur Minderung und Anpassung an den Klimawandel sichergestellt werden soll. Dies umfasst unter anderem grüne Infrastrukturen, Kohlenstoffspeicherung und -abbau. Die Richtlinie fördert gezielt die Begrünung von Dächern und Fassaden, um sowohl die Energieeffizienz von Gebäuden zu optimieren als auch städtische Wärmeinseln zu reduzieren. Regionale und lokale Behörden werden dazu angehalten, Renovierungsprogramme zu entwickeln, die grüne Infrastrukturen einbinden, um die Widerstandsfähigkeit von Gebäuden gegenüber klimatischen Veränderungen zu erhöhen.
Im Entwurf der OIB-Richtlinie 6 (Jänner 2025) werden sowohl die Anpassung der Heiz- und Kühlperioden als auch die neuen Anforderungen der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) in Bezug auf Primär- und Endenergie behandelt. Zudem wird das Thema sommerliche Überhitzung in den relevanten Normen des EPB-Normenpakets, wie etwa in der ÖNORM B 8110-5, berücksichtigt. Diese Normen werden in der OIB-Richtlinie referenziert.
Mit der neuen EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) wird zudem eine Verschärfung der Energieanforderungen im Neubau um 10 % vorgeschrieben.
Ein wesentliches Element dieser Strategie ist das Neue Europäische Bauhaus (NEB), das Nachhaltigkeit, Ästhetik und Inklusion in den Mittelpunkt stellt. Es fördert eine stärkere Verbindung zur Natur, erhöht das Bewusstsein für den Klimawandel und trägt zur Reduzierung der Schadstoffbelastung bei – auch im Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden.
Österreich gehört zu den wenigen Ländern, die über ein staatlich gefördertes Anpassungsprogramm auf regionaler Ebene verfügen. Die sogenannten Klima- und Energie-Modellregionen (KEM) entwickeln nachhaltige Konzepte für Energie und Klimaschutz, um den Übergang zu einer klimaneutralen Energieversorgung voranzutreiben. Im Rahmen der KLAR!-Klimawandelanpassungs-Regionen wird Unterstützung geboten, um sich frühzeitig und aktiv an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Finanziert durch den Klima- und Energiefonds, hilft das Programm insbesondere ländlichen Regionen, Maßnahmen für den Umgang mit Extremwetterereignissen, Hitze, Wassermanagement und Biodiversität zu entwickeln.
Das EU-Renaturierungsgesetz bietet weitere Chancen für die Bauwerksbegrünung. Ziel ist es, degradierte Ökosysteme in der Europäischen Union wiederherzustellen, um die Biodiversität zu stärken und den Klimawandel zu bekämpfen. Bis 2030 sollen mindestens 20 % der EU-Landflächen renaturiert werden, mit dem langfristigen Ziel, bis 2050 alle geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen. Ein Nettoverlust an städtischen Grünflächen und Baumkronen soll bis 2030 verhindert werden, während in den darauffolgenden Jahrzehnten eine schrittweise Ausweitung dieser Flächen angestrebt wird. Immobilienentwickler werden zunehmend dazu verpflichtet, bei neuen Bauprojekten nachhaltige und begrünte Flächen zu integrieren, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Auch der Einsatz umweltfreundlicher und nachhaltiger Baustoffe wird verstärkt gefordert, um den ökologischen Fußabdruck von Bauprojekten zu minimieren.
Im Rahmen des ASAP-Programms 2025 wird aktuell eine F&E-Dienstleistung für ein satellitenbasiertes Monitoring-System für städtische Grünflächen und Baumüberschirmung ausgeschrieben. Ziel ist es, eine kontinuierliche und standardisierte Überwachung urbaner Grünflächen zu ermöglichen, um den Anforderungen des EU-Renaturierungsgesetzes gerecht zu werden. Mithilfe von Satellitendaten sollen zuverlässige und automatisierte Erhebungen über Grünflächen und Baumkronen erfolgen, wodurch Veränderungen über die Zeit erfasst und dokumentiert werden. Ein nationales Berichtssystem wird aufgebaut, das als Datengrundlage für politische Entscheidungen und die Berichterstattung an die EU dient.
Zusätzlich setzen Städte verstärkt auf eigene Grünflächenkennzahlen, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern und den Herausforderungen des Klimawandels entgegenzuwirken. In Salzburg wird ab dem 1. März 2025 die verpflichtende Grünflächenzahl eingeführt, die den Anteil an begrünten Flächen bei Bauvorhaben reguliert. Damit sollen die Auswirkungen der Klimakrise gemildert werden. Die Grünflächenzahl gibt das Verhältnis der begrünten Fläche zur Gesamtfläche eines Baugrundstücks an. In besonders hitzebelasteten Gebieten wird ein höherer Wert gefordert, um das Mikroklima zu verbessern. Sollte die erforderliche Begrünung nicht erreicht werden, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Andernfalls können Verbesserungspflichten oder Verwaltungsstrafen folgen.