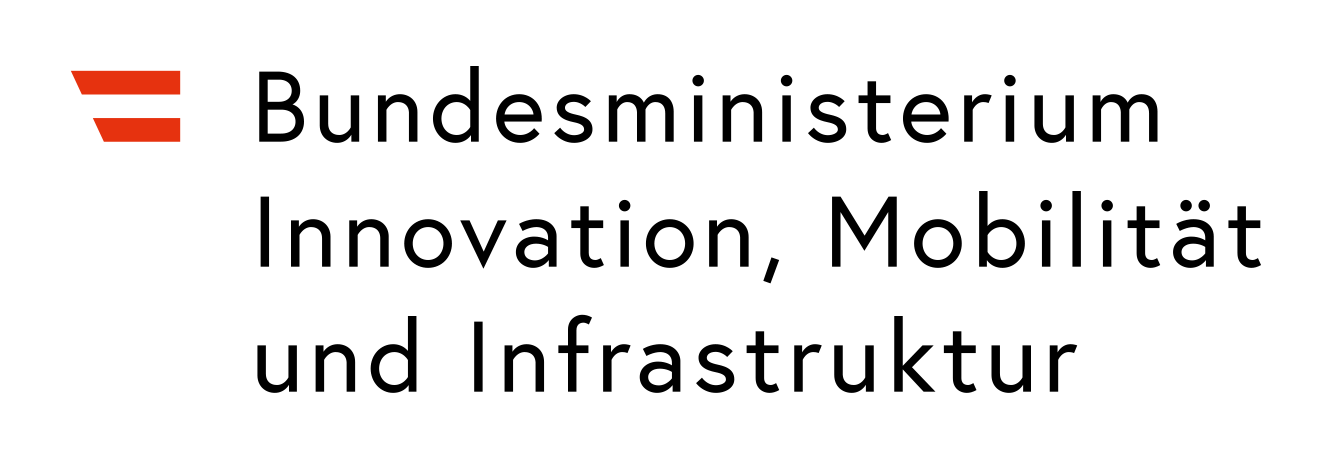Projekt GREENplanout erfolgreich abgeschlossen
Grünflächenfaktor digitalisiert als Digitales Dashboard für klimaresiliente Stadtplanung -ein Proof of concept
Mit Ende September 2025 wurde das Forschungsprojekt GREENplanout, abgeschlossen – und das mit bemerkenswerten Ergebnissen. Im Zentrum stand die Frage, wie sich Digitalisierung und nachhaltige Stadtentwicklung mit Dach-und Fassadenbegrünung noch enger miteinander verknüpfen lassen, um Städte lebenswerter, umweltfreundlicher und widerstandsfähiger zu machen. Das Konsortium, bestehend aus FCP als Projektleitung, Rheologic, GRÜNSTATTGRAU sowie dem Institut für Landschaftsplanung der Universität für Bodenkultur Wien, konnte gemeinsam ein innovatives Werkzeug entwickeln, das künftig die Stadtplanung maßgeblich beeinflussen wird. Gefördert wurde das Vorhaben von der Wirtschaftsagentur Wien.
Kern des Projekts war die Entwicklung eines webbasierten Dashboards als Proof of Concept, das erstmals BIM-Modelle mit mikroklimatischen Simulationen verbindet. Dadurch wäre es möglich, zentrale Leistungskennwerte wie Grünflächenanteile, Lufttemperaturen, gefühlte Temperaturen, Windkomfort oder Luftfeuchtigkeit in einer frühen Planungsphase sichtbar und vergleichbar zu machen. Städte, Gemeinden, Planer:innen und Investor:innen könnten damit in Zukunft verschiedene Entwurfsvarianten durchspielen und ihre klimatischen Auswirkungen direkt gegenüberstellen. Das schafft eine neue Qualität in der Entscheidungsgrundlage: ob für Wettbewerbe, für Genehmigungsverfahren oder für die Beteiligung der Öffentlichkeit.
Grünflächenfaktor digitalisiert
Die Grundfrage war, ob der Grünflächenfaktor digitalisiert werden könnte: Der sogenannte Grünflächenfaktor ist ein Maß dafür, wie viel ökologisch wirksame Grünfläche im Verhältnis zur gesamten Grundstücksfläche vorhanden ist. Bisher wurde dieser Wert oft händisch berechnet, indem die einzelnen Flächenarten – etwa Dachbegrünungen, Bäume, Rasenflächen oder versickerungsfähige Böden – erfasst und mit Gewichtungsfaktoren multipliziert wurden. Diese Faktoren geben an, welchen Beitrag die jeweilige Fläche für Kühlung, Regenwasserrückhalt oder Biodiversität leistet. Der Grünflächenfaktor ergibt sich dann aus der Summe dieser gewichteten Flächen, geteilt durch die Gesamtfläche des Grundstücks.
Im Projekt GREENplanout wurde dieser Ansatz erstmals vollständig digitalisiert und in das Dashboard integriert. Das System kann direkt aus digitalen 3D-Gebäudemodellen (BIM) und Geodaten die relevanten Flächen automatisch erkennen und klassifizieren. Dächer, Fassaden, Innenhöfe oder Freiflächen werden dabei nach Versiegelungsgrad, Begrünung oder Wassernähe unterschieden. Anschließend werden ihnen hinterlegte ökologische Gewichtungswerte zugeordnet, die den jeweiligen Beitrag zum Stadtklima widerspiegeln.
Das Dashboard berechnet den Grünflächenfaktor in Echtzeit und zeigt ihn als zentralen Kennwert an. In der dreidimensionalen Darstellung wird zudem sichtbar, welche Flächen besonders stark zum Ergebnis beitragen. Damit können Planer:innen nicht nur auf einen Blick erkennen, wie grün und klimaresilient ein Entwurf ist, sondern auch verschiedene Varianten miteinander vergleichen. Wird beispielsweise ein Dach zusätzlich begrünt, verändert sich der Faktor sofort, und die klimatischen Effekte – etwa niedrigere Temperaturen oder verbesserte Regenwasserrückhaltung – werden direkt sichtbar.
Durch diese Digitalisierung wird der Grünflächenfaktor zu einem dynamischen Steuerungsinstrument, das Planungsentscheidungen unmittelbar abbildet. Er lässt sich flexibel an lokale Standards wie den Wiener Grünflächenfaktor anpassen und in Kombination mit weiteren Indikatoren nutzen. So wird er von einer statischen Berechnung zu einem interaktiven Werkzeug, das zeigt, wie sich jede einzelne Maßnahme auf Klima, Umweltqualität und Lebensqualität im Quartier auswirkt.
Erste Tests zeigten, dass sich durch den Einsatz von GREENplanout nicht nur die Planung selbst qualitativ verbessern lässt, sondern auch Genehmigungsprozesse beschleunigt werden können. Zudem eröffnet das Dashboard die Möglichkeit, Beiträge zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen wie der EU-Taxonomie oder ESG-Kriterien nachvollziehbar darzustellen. Damit liefert das Projekt einen entscheidenden Baustein für eine zukunftsfähige, klimaangepasste Stadtentwicklung.
Mit dem Abschluss des Projekts endet die Arbeit jedoch nicht. In einer Roadmap hat das Konsortium die nächsten Schritte klar skizziert. Nun könnte das Dashboard aus dem Forschungsstadium in die Praxis zu übergeführt werden. Eine Weiterentwicklung der Systemarchitektur und die Verknüpfung mit weiteren Datenquellen wären notwendig, um eine möglichst nahtlose Integration in bestehende digitale Planungsprozesse sicherzustellen. Darüber hinaus sollen zusätzliche Indikatoren ergänzt werden, etwa zu Lärm, Luftschadstoffen oder Energieverbrauch.