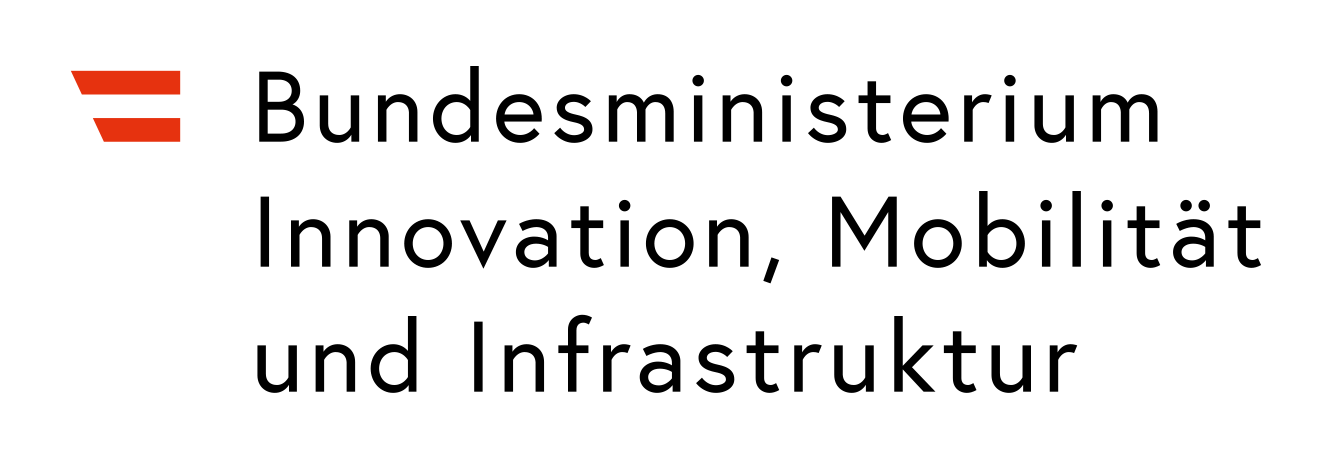Wie viel Kälte brauchen wir in Zukunft?
Herausforderungen, Chancen und die Rolle von Begrünung für ein lebenswertes Österreich. Basierend auf der Studie „UKÖ 2030/2050 – Urbaner Kältebedarf Österreichs“ (Amtmann, Altmann-Mavaddat et al., 2023) und Erkenntnissen aus dem Projekt MAGRET
Der steigende Kältebedarf in Österreich
Der Klimawandel verändert Österreichs Städte rasant. Sommerliche Temperaturen, die früher nur in Prognosen für 2050 erwartet wurden, treten heute bereits regelmäßig auf
. Dadurch wächst die Nachfrage nach technischer Raumkühlung sprunghaft – insbesondere in Wohngebäuden, die bisher noch überwiegend ohne Klimaanlagen auskamen
Wohnungen: Ihr Kältebedarf könnte sich bis 2050 mehr als verdoppeln, teilweise sogar vervielfachen
.Büros: Hier ist der Anstieg gradueller, da viele Gebäude schon mit Kühlung ausgestattet sind – dennoch steigt der Energiebedarf kontinuierlich
.Besonders betroffen sind ostösterreichische Städte wie Wien, wo sich Hitzeinseln bilden und die Nachfrage nach Kühlung in den Sommermonaten am stärksten ansteigt
EMPFEHLUNGEN der STUDIE
Ein wesentlicher Treiber für den steigenden Kühlenergiebedarf ist der kontinuierliche Zuwachs an konditionierter Gebäudefläche, der deutlich über dem Bevölkerungswachstum liegt
Die Studie empfiehlt deshalb: Mehr Sanierungen statt Neubau: Bestehende Gebäude müssen fit für den Sommer gemacht werden.
Thermisch hochwertige Gebäudequalität: Gute Dämmung, Sonnenschutz und adaptive Komfortmodelle können den Kältebedarf erheblich reduzieren
Allerdings zeigt die Analyse, dass selbst Sanierungen nicht alle Effekte kompensieren können – die steigende Zahl an „Kühlgradtagen“ führt zu einem unvermeidbaren Anstieg des Kältebedarfs
.Wie wird das Leben in heißen Städten? Ohne Gegenmaßnahmen drohen in Innenräumen regelmäßig Temperaturen über 26 °C – eine Schwelle, die in Normen wie der ÖNORM EN 16798-1 als Komfortgrenze gilt. Damit wird technische Kühlung zunehmend unvermeidbar.
Doch das bedeutet auch:
· Mehr Stromverbrauch im Sommer – mit Folgen für Netze und Klimaziele
· Höhere Kosten für Haushalte und Betriebe.
· Soziale Fragen, weil nicht alle die gleiche Möglichkeit haben, sich vor Hitze zu schützen.
Begrünung als Schlüsselstrategie
Die Studie zeigt klar: Begrünung ist eine der wirksamsten passiven Maßnahmen zur Senkung des Kältebedarfs
· Gebäudegrün: Gründächer und Fassaden reduzieren Wärmeeinträge, verschatten Fassaden und verbessern das Mikroklima
· Stadtgrün: Parks, Straßenbäume und Wasserflächen senken die Umgebungstemperaturen und bremsen die Entstehung städtischer Hitzeinseln
· Kombinierte Lösungen: Begrünung wirkt besonders effektiv, wenn sie mit baulichen Maßnahmen wie Verschattung, Sonnenschutzverglasung und heller Fassadengestaltung kombiniert wird
Erkenntnisse aus dem Projekt MAGRET
Das MAGRET-Projekt (Maßnahmen für Grüne Resiliente Städte) ergänzt diese Befunde:
Es zeigt, dass naturbasierte Lösungen wie Dach- und Fassadenbegrünung nicht nur das Mikroklima verbessern, sondern auch den technischen Kühlbedarf von Gebäuden um bis zu 30 % reduzieren.
Begrünung steigert die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und unterstützt die Gesundheit der Bevölkerung – ein wichtiger Faktor, da Hitzeperioden auch soziale und gesundheitliche Risiken bergen.
Für die Umsetzung braucht es klare Rahmenbedingungen und Förderungen, da Begrünung initial Investitionen erfordert, langfristig jedoch Betriebskosten senkt.
Fazit: Vorbereitung auf ein heißeres Österreich
Die Studie und das MAGRET-Projekt machen deutlich: Österreich muss sich jetzt auf einen massiven Anstieg des Kältebedarfs vorbereiten. Die zentralen Handlungsfelder sind:
· Sanierung und Anpassung des Gebäudebestands – um den Energiebedarf im Sommer zu reduzieren.
· Stadt- und Freiraumgestaltung mit Grün und Blau – um Hitzeinseln zu entschärfen.
· Integration naturbasierter Lösungen – Dach- und Fassadenbegrünung als Standard.
· Intelligentes Lastmanagement – um die zusätzlichen Strombedarfe der Kühlung netzdienlich zu steuern